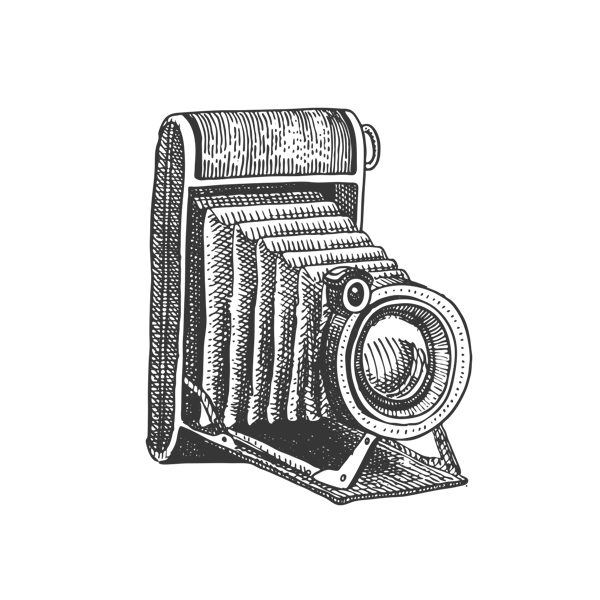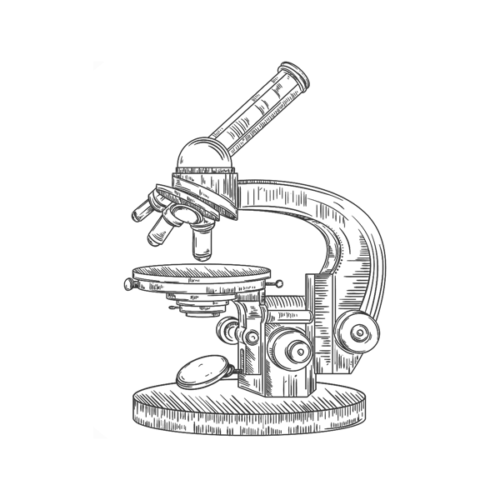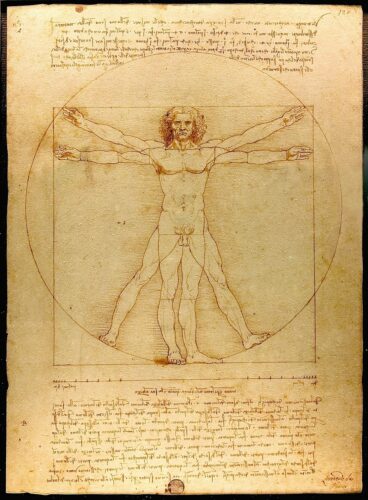Zweifel am Klimawandel, an der Existenz des Coronavirus oder der Sinnhaftigkeit von Impfungen: Das Vertrauen in die Wissenschaft scheint zu schwinden. Ansätze wie Citizen Science Projekte sollen das Verständnis für den Forschungsprozess erhöhen und Vertrauen bilden. Mit welchem Erfolg?
Foto: Demonstration im Namen der Wissenschaft. Credits: Unsplash/Vlad Tchompalov.
Spätestens seit Ex-US-Präsident Donald Trump den Begriff der „Fake News“ populärer gemacht hat, rätseln Kommunikationswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, was Medien gegen Falschinformationen tun können. Zweifel werden aber nicht nur „den Medien“ entgegengebracht. Auch die Institution Wissenschaft ist mit Menschen konfrontiert, die wissenschaftliche Erkenntnisse nicht hinnehmen wollen.
Auch für die Wissenschaft stellt sich daher die Frage: Wie lassen sich zweifelnde oder skeptische Personen von der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft überzeugen? Denn angeblich bekommt diese Gruppe immer mehr Zuwachs. Ein Ansatz, diesem Vertrauensverlust entgegenzuwirken, ist, den wissenschaftlichen Prozess transparenter zu machen. Forschende sollen zeigen, wie ihre Arbeit funktioniert, welche Schritte und Qualitätskontrollen hinter einem wissenschaftlichen Ergebnis stehen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen könnten beispielsweise selbst von ihrer Arbeit berichten und Einblicke gewähren. Ein Paradebeispiel dafür sind die Social-Media-Accounts des deutschen Astronauten Alexander Gerst. Über sie nahm Gerst auch alle Wissenschafts-Laien mit ins All.
Citizen Science heißt: Alle forschen mit
Sogenannte „Citizen Science Projekten“ gehen einen anderen Weg. Sie binden die Bevölkerung direkt in die Forschungsprojekte ein. Interessierte können beispielsweise direkt die Auswirkungen von Lichtverschmutzung in ihrer Nachbarschaft erforschen oder Wildtiere in der Innenstadt von Berlin melden – und so zu wissenschaftlichen Erkenntnissen beitragen. Die Digitalisierung und die Möglichkeit, Daten durch Smartphones zu sammeln, sorgten dafür, dass es einen deutlichen Anstieg solcher Bürgerwissenschaftsprojekte gab. Das berichtete die deutsche Citizen Science Plattform „Bürger schaffen Wissen“.
Museum will nicht Forschung, sondern den Prozess ausstellen
Noch einen Schritt weiter geht das Universitätsmuseum im niederländischen Utrecht. Seit Anfang 2020 wird es zu einem Forschungsraum umgebaut, der allen offen stehen soll. Auf der europäischen Wissenschaftskonferenz ESOF 2020 (Euroscience Open Forum) erklärte der Museumsdirektor Paul Voogt, dass der Forschungsprozess der Mittelpunkt ihrer Ausstellung werden soll. „Wir werden uns noch stärker auf die Bürgerwissenschaft konzentrieren, um den Besuchern zu erlauben, aktiv zur Wissenschaft beizutragen“, so Voogt.
„Wir wollen den Forschungsprozess zeigen, nicht nur die Ergebnisse.“
Paul Voogt, Direktor Universitätsmuseum Utrecht
„Das Universitätsmuseum wird ein Forschungsmuseum sein, in dem der Schwerpunkt nicht auf den Forschungsergebnissen, sondern auf dem Forschungsprozess liegt“, sagte er weiter in einem Interview auf der Museumswebsite. Besuchende sollen so zum Beispiel durch Vorlagen in der Lage sein, Fossilien auf ihre Echtheit zu überprüfen und anhand von Vergleichsmuster die Spezies des Fossils zu bestimmen.
Vertrauen in die Wissenschaft ist nicht gesunken
Obwohl Medien häufig über Menschen berichten, die gegen das Impfen sind oder den Klimawandel leugnen, wächst die Gruppe der selbst ernannten Skeptiker gar nicht. Der „General Social Survey“, der vom National Research Centre in den USA durchgeführt wird, zeigt eher das Gegenteil. Seit 1973 scheint das allgemeine Vertrauen in die Wissenschaft in den Vereinigten Staaten größtenteils gleich zu bleiben. In der „European Social Survey“, dem europäischen Pendant zur Studie, wird das Verhältnis der Bevölkerung zur Wissenschaft nicht abgefragt. Dafür, wie die europäische Bevölkerung insgesamt zur Wissenschaft steht und wie sich dieses Verhältnis im Laufe der Jahre verändert hat, fehlen die Daten.
Für Deutschland werden solche Daten seit 2014 im Wissenschaftsbarometer erhoben, zunächst noch indirekt. 2017 wurde dann die allgemeine Frage „Wie sehr vertrauen Sie in Wissenschaft und Forschung?“ eingeführt. Das Ergebnis: Von 2017 bis 2019 vertrauen im Schnitt etwa zehn Prozent der Wissenschaft „eher nicht“ oder „gar nicht“. Die Zahl der Unentschlossenen lag bei vierzig Prozent, während rund fünfzig Prozent „eher“ oder „voll und ganz“ in die Wissenschaft vertrauen. Dabei schwanken die Zahlen leicht von Jahr zu Jahr – aber ohne erkennbaren Trend.
Das Wissenschaftsbarometer ist eine Umfrage, die seit 2014 von der gemeinnützigen Gesellschaft „Wissenschaft im Dialog“ in Deutschland durchgeführt wird. Bei der Umfrage werden jährlich circa 1000 Menschen in Deutschland per Telefoninterview zu ihrem Interesse an und Vertrauen in die Wissenschaft befragt.
Höheres Vertrauen in die Wissenschaft als in die Politik
So sieht auch das Bild für die Niederlande aus. Nach den Daten des „LISS-Panels“, das dort die entsprechende bevölkerungsrepräsentative Befragungen durchführt, hat sich das Vertrauen der niederländischen Bevölkerung in die Wissenschaft nicht groß geändert. Die Teilnehmenden gaben ihr Vertrauen in die Wissenschaft auf einer Skala von 1 bis 10 an. Von 2007 bis 2015 gaben sie im Schnitt jeweils eine Bewertung von 7 an. Das ist eine bessere Bewertung, als sie ihrer Politik zukommen lassen, die eine Bewertung von durchschnittlich 5 erhielt. Einzelne Umfragen von anderen Institutionen in 2017 und 2018 bestätigen das grundsätzliche Vertrauen der niederländischen Bevölkerung in die Wissenschaft.
Effekt von Citizen Science Projekten schwierig zu messen
Was aber ist von Citizen Science Projekten oder dem Plan für das Universitätsmuseum in Utrecht zu erwarten? Können sie das Verständnis dafür, wie Wissenschaft funktioniert und das Vertrauen in diesen Prozess steigern? Tatsächlich ist das unklar, wie sich am Beispiel des „BioBlitzBcn“ zeigt. In diesem Citizen Science Projekt in Barcelona untersuchen die Teilnehmenden die Artenvielfalt in der katalanischen Stadt.
Dacha Atienza Ariznavarreta ist Forschungsdirektorin am Museum für Naturwissenschaften in Barcelona und untersucht diese Auswirkungen des Projekts. Auf der Konferenz ESOF 2020 erklärte sie, dass es schwierig sei, eindeutige Ergebnisse über Effekte der Citizen Science Projekte zu erhalten. Das Verhalten der teilgenommenen Personen müsste über längere Zeit untersucht werden, um festzustellen, ob sich eine Änderung im generellen Verhalten und in ihren Einstellungen der Wissenschaft gegenüber zeige.
Das Citizen Science Projekt findet regelmäßig in Barcelona statt. Teilnehmende sammeln und identifizieren blitzschnell – daher der Name – binnen 24 Stunden so viele Spezies in der Stadt wie möglich. Die Vielzahl der Teilnehmenden kann weit mehr Daten über die Arten sammeln, als es einzelne Forschende könnten. Die Ergebnisse über die Artenvielfalt und -verbreitung in der Stadt sollen zum Beispiel dabei helfen artgeschützte Bereiche festzulegen. So findet das Projekt in Zusammenarbeit von Bevölkerung, Wissenschaft und Politik statt.
Die Teilnahme an Citizen Science Projekten trägt aber deutlich zum Verständnis des jeweiligen Themas bei, das ist erwiesen. Bei einem Projekt im US-Bundesstaat New Jersey sammelten die Teilnehmenden Daten darüber, an welchen Orten heimische oder invasive Pflanzen wuchsen. Ihr Wissen über und Bewusstsein für die lokale Artenvielfalt wurde vor und nach dem Projekt mithilfe von Tests abgefragt. In den Tests nach Beendigung des Projekts schnitten die Teilnehmenden im Schnitt 24 Prozent besser ab als vor dem Projekt. Ein zusätzlicher positiver Aspekt ist, dass viele Teilnehmende danach motiviert sind, auch bei weiteren Projekten mitmachen. Dass Citizen Science Projekte das Verständnis für wissenschaftliche Prozesse fördern und somit potenziell auch das Vertrauen in die Wissenschaft steigern, ist nicht belegt.
Offene Kommunikation kann überzeugen – gerade in Krisen
Genauso wie der Anteil der Menschen, die in Deutschland den wissenschaftliche Prozesse vertraut, blieb auch der Anteil der „Unentschlossenen“ über die Jahre in etwa gleich groß. Menschen, die bei der Befragung zum Vertrauen in die Wissenschaft „teils teils“ angaben, machten rund 40 Prozent der Befragten aus. Insbesondere in dieser Gruppe können Transparenz und eine offene Kommunikation der Wissenschaft Vertrauen wecken.
Das beweist beispielsweise der NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ mit dem Virologen Christian Drosten und der Medizinerin Sandra Ciesek. In den teils 90-minütigen Gesprächen erklärt Drosten die genauen Hintergründe und Gedankengänge zum Coronavirus, von Tests und Ausgangssperren, über die Wirksamkeit von Masken bis zu Impfstoffen. Gleichzeitig erklärt er aber auch offen, was die Wissenschaftler:innen (noch) nicht wissen und wo die Grenzen der Wissenschaft liegen. Mit Erfolg: Zwischenzeitlich war es der am häufigsten heruntergeladene Podcast Deutschlands. Eine spezielle Corona-Umfrage des Wissenschaftsbarometers im April 2020 zeigt zudem, dass die offene Kommunikation während der Krise in Deutschland funktioniert hat. Ein großer Teil der zuvor unsicheren Befragten gab an, nun stärker in die Wissenschaft zu vertrauen.
„Es ist besser, den Menschen beizubringen, wie man Fragen stellt, als ihnen nur Antworten zu liefern.“
Paul Voogt, Direktor Universitätsmuseum Utrecht
Dass aber nicht nur eine transparente Kommunikation der Wissenschaft selbst helfen könnte, Verständnis und Vertrauen aufzubauen, sprach Museumsdirektor Paul Voogt auf der Wissenschaftskonferenz ESOF 2020 einen an, als er das neue Museumskonzept vorstellte. „Es ist besser, den Menschen beizubringen, wie man Fragen stellt, als ihnen nur Antworten zu liefern. Wir wollen die Bürger nicht davon überzeugen, uns mehr zu vertrauen. Wir wollen mit ihnen in Dialog treten.“