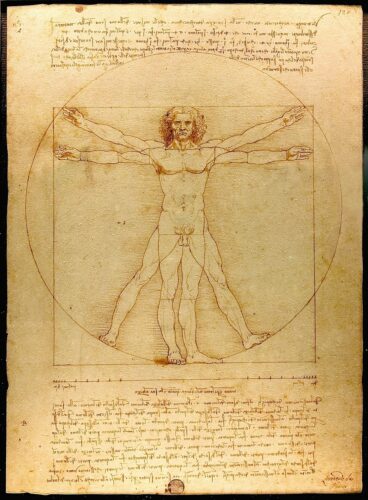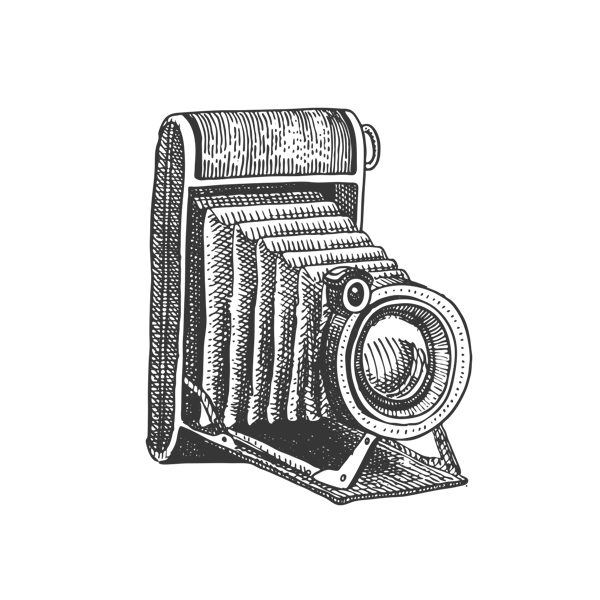Unsere Böden sind krank. Denn der Boden leidet unter der Anreicherung von Pestiziden, Kunststoffen und Medikamentenrückständen, die wir täglich in die Umwelt leiten. Zudem reichern sich giftige Schwermetalle an. Und das kann uns wiederrum schaden, wenn die Kontamination in Getreide und andere Nutzpflanzen für unsere Nahrungsmittel gelangen. Mit großem Gerät lässt sich das beheben. Aber das ist teuer und aufwändig. Eine Alternative dafür könnten ausgerechnet Pflanzen sein. Was steckt dahinter? Und warum ist diese Superkraft der Pflanzen seit Jahrzehnten bekannt und trotzdem nicht im Einsatz? Eine Geschichte über zähe Forschung, fragwürdige Patente und die drängende Hoffnung auf baldigen Einsatz.
Foto: Auf den ersten Blick lässt sich die Superkraft, die manche Pflanzen besitzen, nicht erkennen. Credits: Pexels/ AS Photography
Wir befinden uns im Boden. Im Erdreich. Hier gibt es Humus aus zersetzen Tier- und Pflanzenresten und Mineralien wie Ton, Quarz und Kalk. Hier arbeiten fleißig Pilze und Bakterien, bauen Material ab und um. Auch Regenwürmer helfen. Eine harmonische Vorstellung – aber nicht die ganze Realität. Denn Böden sind heute auch großflächig kontaminiert. Mit Düngemitteln sowie Pestiziden aus der Landwirtschaft, Rückständen aus Lösungsmitteln, Lack und Medikamenten aber auch mit einem Zuviel an giftigen Schwermetallen wie Nickel, Zink und Blei.
Schadstoffe können sich etwa durch Altlasten der Industrie, Müll oder der Landwirtschaft in Böden anreichern und werden, wenn sie schlecht wasserlöslich sind, kaum mit dem Regen wieder herausgespült, beschreibt Professor Rolf-Alexander Düring vom Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Schwermetalle kommen zwar auch natürlicherweise in Böden vor, können jedoch als Folge von Bergbau, Hüttenindustrie oder militärischer Nutzung in zu großen Mengen auftreten – und bleiben. „Denn Metalle sind persistent“, erklärt Düring. Das heißt, dass sie nicht abgebaut werden, sie widerstehen physikalischen und biologischen Prozessen. Das Problem: Diese giftigen Metalle im Boden können in Nutzpflanzen gelangen, ins Grundwasser gespült werden oder als Staub in unsere Lunge dringen. So gelangen sie früher oder später wieder bei uns – der Kreis schließt sich.
Mit großem Gerät gegen Kontamination

So werden die Kontaminationen im Boden gefährlich für unsere Gesundheit. Deshalb versucht sich der Mensch in der Rolle des Wiedergutmachers: Kontaminierte Böden werden heute auf unterschiedliche Weise gereinigt. „Ganz einfach ist, dass man sagt, ich mache einfach einen Betondeckel drüber, damit Schadstoffe sich nicht weiterverbreiten“, beschreibt Düring aus Gießen. Das gelte schon als saniert, da zunächst Leib und Leben nicht in Gefahr seien. Außerdem gebe es physikalische Methoden wie die Adsorption, erläutert der Professor für Umweltchemie. Dabei werden Mittel in den Boden gegeben, an denen sich die Schadstoffe fest binden und so zum Beispiel nicht ins Grundwasser gelangen.
Auch könne man den Boden mit großem Aufwand austauschen: „Der Boden wird ausgebaggert und dann mit dem Güterzug in Richtung Sondermüll gebracht und verbrannt“, erklärt Düring. Oder es werden Waschflüssigkeiten, Tenside, für eine biologische Sanierung genutzt. Dazu werden sie in den Boden gegeben und Schadstoffe werden leichter zugänglich für spezialisierte Mikroorganismen. Die Organismen bauen die Schadstoffe dann ab.
Für diese Pflanzen kein Problem
Doch es könnte auch noch eine weitere Möglichkeit gegen die Kontamination geben. Und zwar eine pflanzliche. Aber: Wenn kontaminierte Böden für uns Menschen gefährlich sind, sind sie es doch auch für Pflanzen, die sich direkt über den Boden mit Nährstoffen versorgen – oder?
Tatsächlich benötigen Pflanzen verschiedene Metalle für ihren Stoffwechsel. Gelangen jedoch größere Mengen in die Pflanzen, kann das toxisch werden. Das hängt aber von der jeweiligen Pflanze ab: Professorin Marie Muehe von der Arbeitsgruppe für Pflanzen-Biogeochemie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und der Eberhard-Karls-Universität Tübingen unterscheidet dabei drei Arten. Die erste, die sensitiven Pflanzen, können auf kontaminierten Böden nicht überleben, auf sie wirken die Schwermetalle giftig. „Sie sind bei kleinen Mengen von Metallen sofort im Stress. Das heißt, dass sie nicht so grün werden, nicht so gut Fotosynthese betreiben und weniger Biomasse haben“, beschreibt Muehe. Der zweite Typus, die toleranten Pflanzen, haben dagegen Strategien entwickelt, die giftigen Metalle gar nicht erst aufzunehmen oder aufgenommene Metalle wieder in die Erde zu transportieren.
Und dann kennt Muehe noch einen dritten Typ Pflanze. Einer, der die Metalle aufnimmt und damit gut leben kann. Die Italiener Minguzzi und Vergnano haben ihn im Jahr 1948 entdeckt. In der Asche einer Steinkrautart fanden sie erheblicher Mengen an Nickel, schreiben sie in ihrem Bericht bei der italienischen Mineralogischen Gesellschaft. Und: Der Pflanze ging es dabei trotzdem gut. Die Entdeckung ließ damals viele unbeeindruckt: Für einen Rechenfehler, eine Illusion, hielt man die Entdeckung in den 50er-Jahren – bis 1967 Jaffré vom Labor für Pflanzenbiologie in Neukaledonien einen später als Nickelbaum bezeichneten Fund machte und darüber im Fachjournal Science publizierte. Der Milchsaft des Baums war blau-grün verfärbt, denn darin hatten sich bis zu 25 Prozent vom Schwermetall Nickel angereichert. Heute ist von der Sonnenblume, vom Gelben Galmei-Veilchen und beispielsweise der Hallerschen Schaumkresse bekannt, dass sie wie ein Staubsauger Schwermetalle aufnehmen können – ohne, dass es sie stört. Diese Pflanzen werden auch als Hyperakkumulatoren bezeichnet.
Wie mit einer Superkraft können diese Pflanzen problemlos Metalle sammeln. Und dann? Schwermetalle werden meist von den Wurzeln in die Blätter verlagert und dort gespeichert, weiß Markus Puschenreiter vom Institut für Bodenforschung in Wien. Zum Beispiel speichern sie hohe Konzentrationen an Nickel, Cadmium oder Zink dort, wo sie den Stoffwechsel der Pflanze nicht stören: In Holräumen oder Zellwänden. Ob Metalle dort eine Funktion haben, ist bisher nicht restlos erklärt. In den Blättern der Pflanze könnten die eingelagerten Schadstoffe aber ein Schutz gegenüber Fressfeinden sein.
Die pflanzliche Superkraft zur Bodensanierung ausgenutzt
Und genau diese Fähigkeit von Pflanzen, Schwermetalle anreichern und Böden entgiften zu können, wollen sich Forschende nun im Kampf gegen kontaminierte Landflächen zunutze machen. Indem Pflanzen Schadstoffe aus dem Boden ziehen und damit den Schadstoffgehalt reduzieren. Sie taufen die Superkraft der Pflanzen Phytosanierung oder Phytoextraktion. Die Pflanzen bauen also praktisch den Boden um und ziehen die Schadstoffe heraus. Die Hoffnung ist, dass man sie beispielsweise an Standorten mit großem Vorkommen von Schwermetallen pflanzen kann. Dazu gehören laut Puschenreiter zum Beispiel alte Bergbaugebiete, bei denen sich die Belastung mit Schwermetallen über mehrere Quadratkilometer erstreckt.
Vorteilhaft gegenüber herkömmlichen Methoden ist diese Sanierung dort zunächst einmal, weil sie nachhaltig ist und der Boden nicht mit großem Aufwand abgetragen werden muss. „Ästhetisch ist es auch. Ein Feld mit Pflanzen sieht besser aus als so eine Mondlandschaft“, sagt Düring aus Gießen. Und auch finanziell könnte sich die Methode lohnen: „Natürlich ist es auch nicht so teuer, wie einen riesigen Abbau mit Transport, mit Verbrennung und Filteranlagen zu machen“, erklärt er. Die Kostenschätzungen variieren dabei jedoch stark.
Für den Einsatz auf kontaminierten Flächen müssen die phytosanierende Pflanzen aber nicht nur Schadstoffe aus dem Boden ziehen können. „Man braucht eine Pflanze, die ein großes Wurzelsystem hat, die ein gutes Mikrobiom anreichern kann, das wiederrum schnell und flexibel die Pflanze unterstützt“, erklärt Muehe. Zudem sei wichtig, dass die Pflanzen schnell wachsen und zum Beispiel viele Blätter entwickeln. „Sie darf auch nicht gleich gestresst sein und eingehen, sobald ein Windchen weht“, ergänzt die Forscherin. Und sie müsse auch mit verschiedenen Bodenbeschaffenheiten und Nährstoffmengen auskommen. Also eine Pflanze, die leben kann wie ein Unkraut oder ein Baum.
Weitere Variante der Phytoextraktion möglich

Den Schadstoffgehalt mittels Pflanzen zu reduzieren – also die Extraktion – ist nur eine Variante der Phytosanierung, weiß Puschenreiter aus Wien. Die zweite ist, dass Pflanzen das Risiko einer Wirksamkeit der Schadstoffe verringern würden. Und das schaffen sie, indem sie die Wirkstoffe im Boden halten, sie stabilisieren. Oder die Mikroorganismen an ihren Wurzeln übernehmen das, wie Muehe weiß. „Das Mikrobiom kann zum Beispiel Metalle selbst festsetzen, sodass sie gar nicht von der Pflanze aufgenommen werden. Oder sie binden die Metalle an ein organisches Gel, was sie abgeben“, erklärt Muehe. Das nennt sich dann Phytostabilisierung.
Ein Nachteil dabei: Bei der Phytostabilisierung bleiben die Schadstoffe trotzdem im Boden – nur gelangen nicht mehr zu den Nutzpflanzen. „Rechtlich gesehen, ist der Boden damit nach wie vor belastet“, erklärt Puschenreiter. Das könnte es auch für Behörden schwieriger machen, die Phytostabilisierung als Sanierungsmethode zu akzeptieren. Auch hält Puschenreiter sie nur für ein temporäres Verfahren, weil immer das Risiko besteht, dass die Schadstoffe hochgeholt werden: „Es braucht nur ein Starkregenereignis, durch das der Boden abgetragen und vielleicht auf umliegenden Ackerflächen abgelagert wird und die werden dann belastet.“
Dem Metallabbau ein Bein gestellt
Während es die Phytoextraktion und -stabilisierung in der Wissenschaft nicht ganz einfach hatten, schien in den 80er-Jahren ein Weiterdreh der Verfahren zunächst größeren Erfolg zu feiern: Dort begeisterte sich nämlich der Umwelt-Agronom des US-Landwirtschaftsministerium Rufus Chaney laut New York Times für die metallsammelnden Pflanzen. Gemeinsam mit Alan Baker, damals Botanik-Professor an der Universität Melbourne, spürte er ein noch größeres Potenzial der Gewächse: Pflanzen, vollgesogen mit Bodenmetallen, könnten das Metall nicht nur für den Menschen sammeln. Man könnte sie danach auch verbrennen und so das Metall aus den Pflanzen holen – und damit Geld machen. Und das umweltfreundlich, günstig und einfach. Diesen pflanzlichen Erzabbau tauften die beiden Forscher Phytomining.
Bald fanden Chaney und Baker auch Förderer für ihre Idee: Die Investmentfirma Viridian Environmental erkannte das Phytomining mit der Zeit als lukratives Geschäft – und sicherte sich 1998 die Patente für alle eventuellen Erfindungen. Das Problem: Die Firma verbot damit jede kommerzielle Nutzung des Verfahrens. 20 Jahre lang. Und sie nutzte das Phytomining auch nicht selbst. Sie ließen das Patent einfach liegen. Warum, bleibt bis heute ungeklärt. Ein Albtraum für die Forschung, wie Marie Muehe bestätigt: „Wir wissen eigentlich enorm viel über diese Prozesse, aber da Phytomining lange patentiert war und brach lag, konnte sie tatsächlich lange nicht als Anwendung genutzt werden. Erst seit ein paar Jahren können wir komplexere Studien durchführen, die uns in der Entwicklung des Verfahrens weiterbringen.“
Die Phytoextraktion ist noch mitten in der Forschung

Zurück zur Extraktion: Die Forschung an ihr läuft immer noch international, denn kontaminierte Böden stellen weltweit eine große Herausforderung dar. Dürings Forscherteam untersucht zum Beispiel aktuell die Phytoextraktion von dem giftigen und weitestgehend persistenten Insektizid DDT, das in Ländern der ehemaligen Sowjetunion wie Georgien und Aserbaidschan angereichert ist. Die zuerst dafür eingesetzten Pflanzen, die Chinaschilfarten, haben nur etwa sechs Monate ausgehalten und sind dann in die Knie gegangen. Aber: „Wir testen jetzt eine andere Pflanze und da sind wir auch die ersten. Wir nutzen jetzt Hanf.“ Hanf sei aufgrund des Wurzelwerks gut geeignet, aber die Forschung daran sei noch längst nicht abgeschlossen.
Auch konzentrieren sich Forschende auf die Mikroorganismen, die den Pflanzen bei der Extraktion helfen. Bereits bekannt ist, dass sie bei der Schadstoffaufnahme, aber auch bei der Aufnahme von Nährstoffen und dem Wachstum der Pflanzen unterstützen. Ein Forscherteam um Magdalena Noszczynska von der naturwissenschaftlichen Fakultät der Schlesischen Universität im polnischen Kattowitz versucht das besser zu verstehen. Sie stellten bereits fest, dass sich der Gehalt an Schwermetallen in den Pflanzen je nach Bakterienstamm im Boden unterscheidet. Und sie konnten identifizieren, dass die Bakterien das Enzym Ammoniak-Monooxygenase für das Zerkleinern von organischen Substanzen nutzen. Die ersten Ergebnisse legen nahe, dass ein großes Potenzial in der Forschung der Mikroben zu den phytostabilisierenden Pflanzen stecken könnte.
Wo bleibt der Durchbruch?
Doch auch wenn die Forschung an Phytosanierung läuft, im großen Stil wird das Verfahren vorerst nicht angewandt. Sind die Staubsauger-Pflanzen etwa doch keine Superhelden? Zumindest haben ihre Kräfte heute wie auch in Zukunft ihre Grenzen. Denn zunächst braucht die Forschung sehr lange, weil auch die Sanierung an sich für sichtbare Effekte Jahre bis Jahrzehnte braucht. Die Forschungsförderung ist aber meistens nur auf drei Jahre ausgelegt, erklärt Düring. Dadurch wird auch die Finanzierung schwierig. Besonders, weil es sich um eine Art Forschungsnische handelt. Kompliziert macht die Forschung auch, dass sie nur mit viel Betreuungs- und Vorbereitungsaufwand funktioniert.
Und dann auch noch vom Gewächshaus aufs Feld zu kommen, stellt Forschende vor noch ganz andere Herausforderungen: In der Natur kann zum Beispiel der Schwermetallgehalt im Boden für die sanierenden Pflanzen zu hoch sein oder auf einem Feld stark variieren. Auch kann es an einem Standort zu wenig Wasser oder zu viel Sonne für die jeweilige Pflanzenart geben. Düring erklärt außerdem, dass Kontaminationen in der Praxis lange her sein können. Und dann setzte ein Alterungsprozess im Boden ein: Die Schadstoffe sind dann fester im Boden verankert, was die Phytosanierung nochmal erschwert.
Außerdem darf Phytosanierung auf landwirtschaftlichen Flächen nicht zu Ernteausfällen führen. Muehe vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hält es für wichtig, die Metallreinigung in der Landwirtschaft mitzudenken, weil phytosanierende Pflanzen womöglich den Stress auf Nahrungsmittelpflanzen reduzieren können. Doch die Planzen zur Bodensanierung sollten dann parallel oder zwischen den Nutzpflanzen angebaut werden, empfiehlt Muehe. Ein Beispiel für einen solchen Anbau wäre der Spinat: „Spinat wird ja viel im Frühjahr und dann wieder im Herbst angebaut. Deshalb könnte man zum Beispiel folgend oder parallel auf Spinat die Pflanze ansetzen, die Metalle entweder stabilisiert oder rauszieht.“
Phytosanierung auf Rezept
„Aber natürlich gibt es Zielkonflikte. Wir müssen Nahrungsmittel produzieren. Das heißt, es ist immer die Frage, wie stark ist die Pestizidbelastung?“, fragt Muehe. Und wie dringend ist dann eine Sanierung überhaupt, wenn man dafür auf Nahrungsmittel verzichten muss? Insbesondere für Landflächen, die heute aufgrund von Kontaminationen nicht für die Landwirtschaft genutzt werden können, hält Düring eine Sanierung aber für unbedingt sinnvoll. „Damit müssen wir jetzt sofort anfangen, es ist fünf vor zwölf.“ Der Boden könne sich zwar selbst heilen, ihm mit Phytosanierung beim Heilen zu helfen, ist aber wie der Tee bei den nächsten Halsschmerzen. Doch wer setzt den auf?